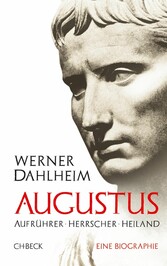Suchen und Finden
I. DIE REPUBLIK DANKT AB
«Es scheint zunächst so, als ob man einen Menschen nach den Hauptzügen seines Lebens beurteilen könnte… Zuerst wird ein Bild des Gesamtwesens konstruiert; dann werden alle Einzelhandlungen einer Persönlichkeit in dieses Gesamtbild eingeordnet… Beim Kaiser Augustus ist das freilich nicht geglückt; denn bei diesem Mann sind die einzelnen Betätigungen so offenbar voneinander abweichend, sie ändern sich während seines ganzen Lebens immer wieder und oft so unerwartet, dass auch die kühnsten Beurteiler nicht zu einer Entscheidung kamen und es aufgeben mussten, ihn in seiner Ganzheit zu erfassen.»
Montaigne[1]
1. Das Vermächtnis Caesars
«Die Republik ist ein Nichts»
Octavian hat die alte Republik kaum erlebt. Im Jahr seiner Geburt beendete der Konsul Cicero die Verschwörung des Catilina, und sein Großonkel Caesar gewann mit den letzten Sesterzen, die er für die fälligen Bestechungen auftreiben konnte, die Wahl zum obersten Priester (Pontifex maximus). Drei Jahre später verbündeten sich Pompeius, Crassus und Caesar und sicherten sich und ihren Anhängern die Macht im Staate. Die Formel, auf die sie sich einigten, hob die Ordnung der Republik aus den Angeln: «Nichts solle im Staat künftig geschehen, was einem von ihnen missfallen sollte.»[2] So blieb es zehn Jahre, in denen Caesar Gallien eroberte, während Octavian fern von Rom in der italischen Provinz aufwuchs. Er wurde dreizehn, als es im Januar 49 zum Bürgerkrieg kam, und als er fünfzehn wurde, hatte Caesar gesiegt. Seine Laufbahn begann im Schatten dieses Mannes, der ihn früh an sich zog und ihn die Grundregeln von Politik und Krieg lehrte. Was davon wirklich zählte, erfuhr der Jüngling in den letzten Lebensmonaten seines Großonkels.
Dieser war Anfang Oktober 45 nach seinem Sieg in Spanien in Rom eingezogen und hatte seinen fünften Triumph ausgerichtet. Viele weinten, als sich der Sieger in strahlender Laune bejubeln ließ, feierte er doch als erster Römer einen Erfolg über die eigenen Bürger. Die Zahl der Gefallenen zu veröffentlichen, hatte der Diktator verboten – trotzdem lastete sie wie ein Alptraum auf der Zukunft. Als der Wagen des Triumphators an der Bank der Volkstribunen vorbeifuhr, blieb einer von ihnen sitzen, voll Zorn auf einen Helden, der sein Volk verhöhnte. «Fordere doch», rief ihm der Diktator zu und schüttelte die Faust, «fordere als Volkstribun die Republik von mir zurück.»[3]
Es ist leicht zu verstehen, was in diesem Augenblick in Caesar vorging, und es spiegelt das Selbstverständnis der großen Krieger Roms. Er hatte Gallien der Republik zu Füßen gelegt, fünf lange Jahre in nahezu allen Provinzen gekämpft und vielen, auch den hartnäckigsten Gegnern, Leben und Ehre gelassen. Was sollte er noch tun, um als der erste Mann anerkannt zu werden? Sollte die immer wieder und nur mühsam unterdrückte Ahnung doch Gewissheit werden, dass ihm weder die Toten noch die Lebenden vergeben würden? Sicher, er kam als der Herr Roms, aber doch wie ein auswärtiger Eroberer, dessen Herrschaft in Mord und Brand enden musste, wenn sie nicht den Verstand und das Herz der alten regierenden Klasse gewinnen konnte. Ihr Widerstand verdammte ihn zum Zerstörer der alten Ordnung, dem Vergebung nicht gewährt und dessen Gnade nicht genommen wurde. In seinen Augen ignorierten seine Gegner schlicht die Veränderung der Welt und schwenkten hochfahrend wie eh und je das Banner der Republik, hinter dem sich doch nur der eigene Hunger nach Macht und die eigene Gewalttätigkeit verbargen.
So wurde für den schwer Gereizten «die Republik zum Nichts, zum Namen ohne Körper und greifbare Gestalt». Die naheliegende Erinnerung an Sulla, der den Staat restauriert und die Diktatur niedergelegt hatte, empfand er als lästig. Sulla sei ein Analphabet gewesen, beschied er barsch seine Kritiker.[4] Er beschrieb damit die Wirklichkeit, wie er sie sah: Wer erwartete, mit den alten Spielregeln weiterwursteln zu können, wollte nicht begreifen, dass die Republik von sich aus nicht mehr lebensfähig war. So konnte er guten Gewissens erklären, «es liege mehr im Interesse des Staates als in seinem eigenen, dass er unversehrt bleibe. Er habe genug Macht und Ruhm gewonnen; wenn ihm etwas zustoße, werde das Land keine Ruhe finden, sondern von neuen Bürgerkriegen unter weit furchtbareren Bedingungen als bisher heimgesucht werden.»[5] Drei Wochen nach den Iden des März griff sein alter Freund Matius den Gedanken wieder auf, dessen Logik Rom weitere 15 Jahre quälen sollte: «Wenn Caesar mit seinem Genie keinen Ausweg fand, wer wird ihn dann finden?»[6]
Beantwortet wurde die Frage erst in den zwanziger Jahren. Die Umstände, unter denen sie gestellt worden war, hatten sich nicht wesentlich geändert. Octavian wie Caesar verdankten ihre Macht dem Schwert, und auf ihm ruhte ihre Alleinherrschaft. Ihr Charakter war despotisch und bedurfte, um in Rom anerkannt zu werden, eines rechtlichen Überbaus. Wie man zu ihm gelangen konnte, zeigten die seit Sulla betretenen Pfade. Sie führten entweder zur altrömischen Diktatur, die Sulla in den Geschichtsbüchern entdeckt und mit allumfassenden Kompetenzen angereichert hatte, oder zum Konsulat, dem höchsten und ehrwürdigsten Staatsamt der Republik, oder zu den Ausnahmekommandos (imperia extraordinaria) des Pompeius, die den Krieg bis an die Grenzen der Erde möglich gemacht hatten. Wofür man sich auch entschied: Die Macht, die diese Ämter und Amtsvollmachten gewährten, gab es immer nur auf Zeit, und niemals wurde die Autorität von selbst dazugegeben. Sie floss namentlich aus dem Beifall der herrschenden Klasse, und diese war um keinen Preis gewillt, eine Macht ohne zeitliche und inhaltliche Schranken zuzulassen.
Ein gangbarer Weg schien die Diktatur. Im Herbst 48 übernahm Caesar sie für ein Jahr und ließ sie im April 46 auf zehn Jahre ausdehnen. Damit verlor wenigstens für die Wohlmeinenden das Amt nicht gänzlich seinen Charakter als Jahresamt. Mit diesen taktischen Finessen und Rücksichten war es 45 vorbei. Ende des Jahres kündigte Caesar eine unbefristete Amtszeit an, und am 15. Februar 44 führte er offiziell den Titel dictator perpetuus.[7] Damit büßte das Amt endgültig den Charakter eines Ausnahmemandats ein und ging über in die souveräne Gewalt. Jede Hoffnung auf Frieden mit der Republik war nun dahin. Seinem Stand galt Caesar fortan als Tyrann. Es war dies die treffende Bezeichnung für den Mann, der die politische Allgewalt des Senatsadels abschaffte und damit der Republik den wichtigsten Baustein ihrer Freiheit nahm. Das alte politische System ging aus den Fugen, und was das Ämterwesen ausgemacht hatte, zerfaserte: statt Annuität zählte nun die Dauer, die Kollegialität schwand zugunsten der Kumulation von Macht, und was einst gleich war, erschien nun hierarchisch geordnet. Die monarchische Gewalt begann ihre neuen Ordnungsprinzipien auszuprobieren.
Die Aura des Göttlichen
Die ihm aus allen Teilen des Reiches zuteilwerdenden Gesten gläubiger Demut haben Caesar zunächst kaum beeindruckt. Dann aber begann er den Götzendienst um seine Person ernst zu nehmen. Floss doch aus der Gewissheit der Massen, dass seine absolute Macht eine Heilsnotwendigkeit sei, die Autorität, die ihm viele seiner Standesgenossen beharrlich verweigerten. Nach den Siegen in Afrika und Spanien ergoss sich eine schier endlose Flut von Ehrungen über Caesar, gepaart mit mythischen Verklärungen seiner Ahnen. Selbst der Senat tat das Seine dazu. Willfährig riss er selbst die Schranken des guten Geschmacks ein, um der Macht die schuldige Ehre zu erweisen.[8] Anfang 44 proklamierte er den Divus Julius und gelobte seiner herrscherlichen Milde (clementia) einen Tempel. Der Kalender füllte sich mit Geburtstags-, Sieges- und Gelübdefesten zu seinen Ehren. Und schließlich sollte er – anders als alle anderen Sterblichen – dereinst innerhalb der Stadtgrenze Roms (pomerium) beigesetzt werden.
Alle diese Ehrungen hoben Caesar in die Sphäre des Göttlichen. Dort fand er ein der sozialen und politischen Wirklichkeit näheres Gesetz, als es die Berufung auf die Tradition der Republik war. Die Gebete, die in den Provinzen des Ostens laut und in Italien und den Westprovinzen noch verhalten dem allmächtigen Diktator galten, kündeten von einer monarchischen Herrschaft, die ihre Legitimation aus den Heilserwartungen der Untertanen bezog. Denn der omnipotente Weltherrscher, der in der Person Caesars zum ersten Mal die Bühne des Imperiums betrat, war nur vorstellbar als Sachwalter göttlicher Kräfte. Caesar wollte dies so. Es führte ihn und Rom weit in die Zukunft und über die republikanische Tradition hinaus.
Das Vermächtnis des Scheiterns
Was aber wollte er mit der Macht, die ihm der Sieg über seine Feinde verschafft hatte? Wie Sulla die Früchte aller Mühen auf seinen Landgütern zu genießen, war seine Sache nicht. «Vielmehr sehnte er sich», schrieb Plutarch,...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.