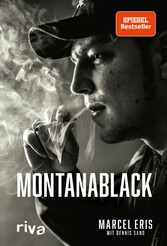Suchen und Finden
Mehr zum Inhalt

MontanaBlack - Vom Junkie zum YouTuber. Die Autobiografie des erfolgreichsten deutschen Gaming-Streamers mit Millionenreichweite auf YouTube und Twitch
PROLOG
Es ist die Hoffnung, die uns Menschen auch in unseren dunkelsten Stunden am Leben hält. Die Hoffnung auf ein Leben, das besser ist als das, welches wir gerade führen. Doch das Gefühl der Hoffnung besitzen nur die Menschen, die wissen, was es heißt, eine Perspektive zu haben. Meine gegenwärtige Perspektive beschränkt sich auf vier Quadratmeter, auf ein unmöbliertes Zimmer mit einem vergitterten Fenster. Vielleicht kommt dieser Ort dem nahe, was einige Menschen die Hölle nennen. Aber die Hölle war nicht dieser Raum. Die Hölle war nicht diese Klinik. Die Hölle, das waren wir selbst. Die Hölle war ich. Ich war an meinem Tiefpunkt angelangt. Ich war unten. Ich war ganz tief unten. Das wusste ich.
An diesen Ort zu gehen war das Eingeständnis, dass ich am Ende war. Ich weiß nicht, ob ich es allein geschafft hätte. Ob ich den Weg allein gefunden hätte. Aber ich wurde ein Stück weit begleitet. Oma und Sabrina haben mich hierhergebracht. Es waren drei lange Stunden Fahrt. Drei Stunden, in denen keiner von uns auch nur ein Wort sprach. Ich lehnte mich gegen das Autofenster und starrte auf die vorbeiziehende Landschaft. Da war nicht viel. Da war bloß Asphalt. Und ein paar kahle Bäume, die an den Rändern der Autobahn standen. Ich kannte den Ort nicht, zu dem wir fuhren. Ich wusste nur, dass er mitten im Niemandsland war. Weit entfernt von einer großen Stadt. Omi wechselte von der Autobahn auf die Landstraße, und die Welt außerhalb der Fensterscheibe veränderte sich. Mehr Bäume, weniger Beton. Sabrina machte das Radio an. aber sie bekam keinen Sender rein. Nur Störfrequenzen. Sie drehte es wieder aus. Draußen begann ein leichter Nieselregen. Das Wetter passte zu unserer gedrückten Stimmung. Ich kurbelte das Fenster leicht runter, um wenigstens ein wenig frische Luft zu bekommen. Dann baute sich vor uns am Horizont langsam ein weißer Gebäudekomplex auf.
»Ich glaube, das ist es«, sagte Omi. Ich nickte. Als sie auf dem Parkplatz hielt, spürte ich, dass hier etwas endete. Dass hier ein Teil meines Lebens sein Ende fand. Manchmal müssen Dinge enden, damit neue Dinge beginnen können, dachte ich mir. Wir stiegen aus Omis dunkelblauer E-Klasse aus. Sabrina strich mir über den Kopf und drückte mir die Hand.
»Du schaffst das«, flüsterte sie mir zu. Ich nickte. Klar. Ich schaffe das. Welche Wahl habe ich denn auch? Wir betraten das große Gebäude durch eine automatische Glastür. Meine Tasche hielt ich fest umklammert, sie war alles, was ich jetzt noch hatte. »Ist doch nett«, sagte Oma. Ich wusste, dass sie nicht meinte, was sie sagte. Dann ging sie zum Empfang, wo eine junge Krankenschwester saß, und erkundigte sich, wo wir jetzt hinmüssten.
»Erdgeschoss, diesen Gang hier ganz durch. Sie sehen dann, wo es ist. Ich gebe den Kollegen schon einmal Bescheid.«
Die junge Frau in dem weißen Kittel musterte mich von oben bis unten. Ich fühlte mich wie ein Schwerverbrecher. Mir ging es mies. Mir ging es wirklich richtig mies. Ich trottete los und kam in den großen Flügel – »Entgiftungsstation« stand da. Wir folgten dem langen Gang bis zu einer großen, schweren Tür, die von einer Art Metallkäfig umgeben war. Dort wartete schon ein Arzt. Der Mann trug einen weißen Kittel. Er hatte graue Haare, einen Schnurrbart und ein gütiges Gesicht. Er nickte uns zu.
»Gut, Omi«, sagte ich. »Aber hier muss ich jetzt allein weiter.«
»Du tust das Richtige, mein Junge!«, redete sie mir gut zu. »Ich bin stolz auf dich.«
Dann nahm ich sie in den Arm und fing an zu weinen. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte keine Schwäche zeigen. Aber es ging nicht anders. Es brach einfach aus mir heraus. Ich weinte nicht um mich. Ich weinte, weil meine Oma hier stand und mir noch immer gut zusprach, nach allem, was ich getan hatte. Nach allem, was ich ihr angetan hatte. Ich schämte mich so wahnsinnig. Und doch hielt sie noch zu mir. Ich durfte sie jetzt nicht enttäuschen. Ich durfte sie jetzt nie mehr enttäuschen, dachte ich mir. Oma streichelte mir über den Rücken. Ich sah, wie auch ihre Augen feucht wurden, aber sie war jetzt stark für uns beide. Dann gab ich Sabrina einen Kuss.
»Ich liebe dich«, sagte meine Freundin.
Ich drehte mich ein letztes Mal um, winkte den beiden zu und ging dann zu dem Arzt, der schon auf mich wartete. Er gab mir die Hand und lächelte mich milde an.
»Das wird schon wieder«, sagte er in einem ruhigen Ton. Das hatte er wahrscheinlich schon sehr, sehr vielen Leuten gesagt, die hier vor ihm standen. Vor dieser großen schweren Tür. Dieser Pforte in eine andere Welt. Ich fragte mich, wie oft es wirklich wieder etwas wurde.
Der Mann öffnete den Metallkäfig und gab mir zu verstehen, dass ich vorgehen sollte. Als ich die Schwelle überschritten hatte, zog er die Tür hinter sich wieder zu und schloss sie zweimal ab. Ich hörte das metallische Geräusch des Schlüsselbundes. Ich fühlte mich, als wäre ich im Knast. Und irgendwie war ich das ja auch. Die Entgiftungsstation war nicht zugänglich für normale Patienten. Man konnte hier nicht einfach kommen und gehen.
»Bitte«, sagte der Arzt und gab mir zu verstehen, dass ich den Flur entlanggehen sollte. Das helle Neondeckenlicht blendete mich. Die Wände waren weiß gestrichen. Es hingen vereinzelte Bilder da, abstrakte, eingerahmte Malereien. Ich schleppte mich über den mit grauem Linoleum belegten Boden. Mein Körper fühlte sich schwer an. Alles war so schwer. Ich hatte das Gefühl, ich würde die Last der Welt auf meinen Schultern tragen.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte mich der Arzt.
»Ja, alles in Ordnung.« Ich ging weiter.
Am schlimmsten war der Geruch. Dieser klassische Krankenhausgeruch. Es fühlte sich alles so unreal an. Als wäre ich gefangen in einem bösen Traum. In einem bösen Traum, der einfach nicht mehr enden wollte.
»Hier herein, bitte.« Der Mann führte mich in sein Büro. Ein großer Raum mit einem riesigen Schreibtisch, auf dem sich die Akten stapelten. An der Wand stand ein Bücherregel, das vollgepackt war mit medizinischer Fachliteratur. Ich setzte mich auf den Holzstuhl, während sich der Arzt mir gegenüber in seinen schweren Ledersessel fallen ließ.
»Ich muss Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, ist das in Ordnung?«
»Natürlich.«
»Ihr Name ist …«
»Marcel Eris.«
»Marcel Eris. Hier haben wir es. Geboren sind Sie am 2. März 1995?«
Ich zögerte kurz. »Richtig.«
»Und Sie sind polytoxikoman, wie ich Ihrer Akte entnehme?«
Ich schaute den Mann an. Ich hatte dieses Wort noch nie gehört. »Was heißt das?«
»Oh, entschuldigen Sie bitte. Medizinerdeutsch. Das bedeutet: mehrfachabhängig. Sie sind abhängig von mehreren Substanzen?«
Ich dachte kurz nach und nickte.
»Ja. Hauptsächlich Cannabis und Kokain.«
»Beruflich machen Sie momentan …«
»… ich bin arbeitslos.«
»Und wohnen tun Sie …«
»Eigentlich wohne ich bei meinen Großeltern. Aber … ich bin derzeit auch obdachlos.«
Es tat mir weh, das auszusprechen. Ich schämte mich. Wie tief bin ich in den letzten Jahren nur gesunken? Wie konnte ich mein Leben nur so versauen? »Ihre Sachen …«, sagte er und zeigte auf meine Tasche, in die ich mein restliches Zeug gepackt hatte, das mir noch geblieben ist.
»… die dürfen Sie hier leider nicht mitnehmen. Wir verwahren das aber alles für Sie auf, Herr Eris.«
»Wieso darf ich das nicht behalten?«, fragte ich ihn etwas schockiert.
»Wissen Sie, wir haben in der Klinik sehr viele Suchtkranke. Wir haben hier schon Menschen gehabt, die haben eine Deoflasche aufgeschraubt und ausgetrunken, nur damit sie ihre Alkoholsucht befriedigen konnten.«
»Ich verstehe.«
Es fiel mir schwer, mich auch noch von meinem restlichen Hab und Gut zu trennen. Aber ich war bereit, alles zu tun, was nötig war.
Ich ging in einen Waschraum, wo ich mich komplett ausziehen musste.
Dann wurde ich untersucht. Nach einer guten Stunde waren wir fertig.
»Sie bekommen morgen ein Zweibettzimmer, Herr Eris. Heute haben wir leider nur noch ein Vierbettzimmer für Sie. Kommen Sie bitte mit.«
Ich folgte ihm den Gang entlang, bis er auf eine Tür zeigte.
»Ruhen Sie sich etwas aus, wir sehen uns dann morgen.«
Ich öffnete das Zimmer. Es war klein. Viel kleiner, als ich erwartet hatte. An den Wänden standen zwei Hochbetten. Drei davon waren belegt. In der Mitte des Raumes war ein Tisch, an dem ein großer, schwerer Mann saß. Er hatte überall Tätowierungen. Auf den Armen, auf den Händen, sogar im Gesicht. Wildes Zeug....
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.