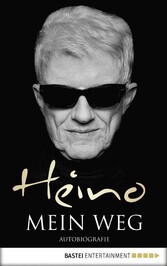Suchen und Finden
Schon als Kind spielte Musik eine große Rolle in meinem Leben. Wir waren schon immer eine ziemlich außergewöhnlich musikalische Familie. Mein Opa väterlicherseits, Bartholomäus Kramm, war Kantor in der Kirche in Köln-Dellbrück. Er unterrichtete Klavier und spielte früher im Kölner Dom die Orgel. Onkel Karl, den alle nur »Kallemann« nannten, spielte Akkordeon, zusammen mit meinem Onkel Schorschi in der Band 4 Westen. Ich sang wie ein Glöckchen, und auch meine fünf Jahre ältere Schwester Hannelore war und ist eine begnadete Sängerin. Vor allem aber war meine Mutter Franziska mit einer wunderschönen Stimme gesegnet. Auch wenn wir damals nicht viel besaßen, so haben wir zu Hause stundenlang miteinander musiziert und hatten dabei viel Spaß. Onkel Kallemann, Onkel Schorschi und ich sangen zu den bekannten Schlagern selbst gedichtete lustige Texte. Aber wir sangen auch die gängigen Schlager dieser Zeit nach: »Die Capri-Fischer« und »Schenk mir deine Liebe, Signorina« von Rudi Schuricke oder »Maria aus Bahia« von René Carol zum Beispiel.
Mit meinen Gesangsdarbietungen in der Familie verdiente ich mir den einen oder anderen Pfennig hinzu. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich als neunjähriger Junge jeden Tag einen Umweg zur Schule in Kauf nahm, ja eigentlich sogar in die verkehrte Richtung lief, aus einem ganz besonderen Grund: In der Düsseldorfer Ellerstraße gab es ein Musikgeschäft, in dessen Schaufenster die tollsten Instrumente ausgestellt waren. Und seit einiger Zeit stand da auch ein wunderschönes rotes Akkordeon. Das schaute ich mir jeden Tag an – einmal auf dem Hinweg zur Schule und einmal auf dem Rückweg nach Hause. Ich presste meine Nase fest an das Schaufenster und stellte mir vor, wie es wohl wäre, wenn ich nur ein einziges Mal auf diesem Akkordeon spielen dürfte, es nur ein einziges Mal in den Händen halten dürfte. Ich malte mir aus, wie schön es wohl klingen würde. Jeden Tag schwärmte ich meiner Mutter davon vor: »Du musst dir das ansehen, es ist einfach wunderbar.«
Ein- oder zweimal ging Mama mit mir zum Musikgeschäft. Zusammen blickten wir in das Schaufenster, doch hinein trauten wir uns nicht. Und das lag nicht nur daran, dass meine Mutter recht zurückhaltend und schüchtern war. Nein, schon von außen konnten wir das Preisschild erkennen – und das raubte uns alle Illusionen! 330 Mark sollte das Akkordeon kosten! »Junge, es tut mir leid, das können wir uns nicht leisten«, sagte meine Mutter immer wieder zu mir, da half kein Betteln. Natürlich war ich ein wenig traurig, aber schon mit neun Jahren wusste ich, dass 330 Mark eine ganze Menge Geld war – auf jeden Fall viel zu viel für uns. Mama musste meine Schwester und mich alleine durchbringen, doch als Reinigungskraft verdiente Sie nur 1 Mark und 20 Pfennige in der Stunde. Das Geld reichte vorne und hinten nicht. Schweren Herzens fand ich mich also damit ab, dass das Akkordeon ein schöner, aber unerreichbarer Traum bleiben würde.
Finanziell ging es uns nie wirklich gut, vor allem die ersten Jahre meiner Kindheit waren nicht leicht. Am 13. Dezember 1938 wurde ich in Düsseldorf geboren, nur wenige Monate später begann der Zweite Weltkrieg. Mein Vater Heinrich, ein Zahnarzt, wurde im Krieg als Funker eingesetzt. Doch schon am 2. August 1941 starb er, als ein betrunkener Kamerad wild um sich schoss, während die Truppe beim Abendessen saß. Mit achtundzwanzig Jahren war meine Mutter plötzlich Witwe – und ich gerade drei Jahre alt. Kein Wunder, dass meine Erinnerungen an meinen Vater ganz verschwommen sind. Mein letztes Bild: Ich saß in unserer Küche, als er auf Heimaturlaub nach Hause kam. Das war ganz kurz vor seinem Tod.
Von da an war es meine Mutter, die alleine für meine Schwester Hannelore und mich sorgen musste. Sie erzog uns mit unendlich viel Liebe, obwohl sie tief in ihrem Inneren sehr traurig war – was sie vor uns Kindern immer zu verbergen versuchte. Es war ihr wichtig, dass wir trotz der Wirren des Kriegs eine möglichst unbeschwerte Kindheit und Jugend erleben durften. Dafür tat sie, was sie konnte, und das war nicht immer leicht. Unser Stadtteil Oberbilk wurde nämlich durch Bomben schwer zerstört. Noch im selben Jahr wurden wir deshalb nach Pommern evakuiert, genauer gesagt nach Großenhain bei Dresden, um den Bombenangriffen auf das Rhein-Ruhr-Gebiet zu entgehen.
Wie wir dahin kamen, weiß ich nicht mehr. Woran ich mich aber lebhaft erinnere, ist meine Einschulung im Herbst 1944, kurz vor meinem sechsten Geburtstag. Meine Mutter hatte mir eine wunderschöne Schultüte geschenkt, die war riesengroß, viel größer jedenfalls als ich. Meine Augen leuchteten, als Mama sie mir in die Hand drückte. Ich sehe sie heute noch vor mir: Grüngolden schimmerte sie und war gefüllt mit leckeren Süßigkeiten. Es war zwar nicht übermäßig viel drin, weil wir ja nicht allzu viel besaßen. Aber immerhin ein paar Bonbons, Schokolade, Äpfel – alles, was Kinder mögen. Ich drückte die Tüte an mich und war total glücklich, weil mich Mama damit so lieb überrascht hatte. Es war ihr wichtig, dass ich wie die anderen Kinder am ersten Schultag auch mit einer schönen Schultüte in meinen neuen Lebensabschnitt startete. Die anderen Kinder waren mir noch fremd, aber schnell fand ich neue Freunde in der Klasse. Allerdings gab es während dieser Zeit kaum regelmäßigen Schulunterricht aufgrund der unzähligen Bombenangriffe. Noch immer erinnere ich mich daran: Ich höre die schrillen Sirenen. Wenn sie ertönten, bedeutete das, dass ein Luftangriff unmittelbar bevorstand. Dann riefen alle: »Licht aus!«, und wir rannten in den Keller. Nie wussten wir, wie lange wir dort bleiben müssten, wie lange die Angriffe dauern würden. Auch diese stickigen, düsteren Keller werde ich nie vergessen.
Allgegenwärtig war der nagende, quälende Hunger. An so manchem Abend gingen wir mit knurrendem Magen ins Bett und konnten kaum einschlafen. Auch am nächsten Morgen wurde es nicht besser: Mehr als eine Scheibe Graubrot, dünn mit Margarine bestrichen, war zum Frühstück nicht drin. Noch heute mag ich kein Graubrot, doch damals war ich froh, wenn es überhaupt etwas gab.
Trotz Krieg, Evakuierung und Hunger war ich kein unglückliches Kind. Ich hatte meine Mutter, meine Schwester, meine Freunde. Meine kleine Welt war so weit in Ordnung – bis zu jenem Tag Ende Februar 1945, als wir Hals über Kopf aus Großenhain flüchten mussten. Ich spielte mit Freunden auf der Straße, als meine Mutter ganz aufgeregt zu mir gelaufen kam und rief: »Heinz Georg, die Russen kommen, wir müssen weg!« Ich verstand nicht, was sie meinte. Denn mir gefiel es da auf dem Land: Ich hatte meine Freunde, ich wollte nicht weg. Ich fing an zu weinen, konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen. Doch es kursierten viele schreckliche Geschichten über die Russen. Es hieß, sie plünderten, vergewaltigten die Frauen und zerstörten alles. Ich verstand das überhaupt nicht, aber ich sah die Angst in den Augen der anderen, alle waren in heller Aufruhr. Es half nichts, wir mussten weg. An den Tag, als wir Großenhain verließen, kann ich mich noch lebhaft erinnern: Ein eiskalter Wind fegte über das Land. Unsere Mutter zog uns an und machte uns reisefertig. An unseren Kleidern befestigte sie weiße Bänder, falls wir unterwegs verloren gehen sollten. Auf den Bändern standen unsere Namen und die Adresse unserer Großmutter in Düsseldorf.
Die Flucht war furchtbar anstrengend. Auch hier knurrte uns ständig der Magen. Ab und zu schenkten uns die Bauern unterwegs eine Steckrübe. Meine Mutter gab sie uns immer gleich morgens, damit wir die Kraft hatten, den Tag zu überstehen. Sie selbst aß nur ganz wenig, damit mehr für uns übrig blieb – obwohl sie es war, die den Bollerwagen mit unseren wenigen Habseligkeiten ziehen musste, fast den ganzen weiten Weg von Pommern zurück ins Rheinland.
Ende Mai 1945 kamen wir zwar völlig erschöpft und mit durchgelaufenen Schuhsohlen, aber unendlich glücklich zu Hause in Düsseldorf an. Der Krieg war vorbei, wir lebten noch und konnten uns in unserer alten Heimat ein neues Leben aufbauen. Als wir unsere Straße erreichten, konnten wir es kaum glauben: Fast alle Häuser waren zerstört, aber unseres stand noch – es war wie ein Wunder! Meine Mutter weinte vor Erleichterung und Freude. Wir zogen in das Haus von Oma, und wir waren nicht allein: Zusammen mit Mamas beiden Brüdern und ihren vier Schwestern waren wir zehn Personen, die sich drei Zimmer und wenige Betten teilten, anders ging es nicht. Meine Mutter schlief mit meiner Schwester in einem Bett, ich bei meiner Oma. Es ging zwar ziemlich eng zu, aber ich empfand es als heimelig und schön. Wir waren eine Familie – und wir hielten zusammen.
In Düsseldorf wurde ich neu eingeschult, alles begann von vorne. Meine Mutter fand schnell Arbeit und hatte gleich viel zu tun: Jeden Morgen stand sie um 5 Uhr auf und putzte für die englischen Streitkräfte die Büros im Stahlhof, der nach dem Krieg als Kommandozentrale der Engländer diente. Abends kellnerte sie im Gasthaus Fischl. Fast rund um die Uhr schuftete sie, damit wir uns etwas leisten konnten. Sie wollte uns unsere kleinen Wünsche erfüllen können, wir sollten es besser haben als sie. Von ihrem Geld kaufte sie mir meine ersten Schuhe aus Kunstleder, dazu ein rotes Jäckchen aus Samt, wie es gerade modern war. Ihr Sohn sollte schick aussehen! Meine Mutter stotterte dafür den Betrag in kleinen Monatsraten zu je 5 Mark ab. Für meine Schwester und mich ging sie...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.