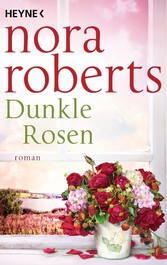Suchen und Finden
Prolog
Memphis, Tennessee
Dezember 1892
Sie kleidete sich sorgfältig an und achtete dabei so genau auf Einzelheiten ihrer Erscheinung, wie sie es seit Monaten nicht mehr getan hatte. Ihre Kammerzofe war schon vor Wochen davongelaufen, und sie konnte und wollte keine neue einstellen. Also verbrachte sie selbst eine Stunde mit der Brennschere – wie in den Jahren, bevor sie von vorn und hinten bedient worden war – und kräuselte und frisierte ihr frisch gewaschenes Haar mit peinlicher Genauigkeit.
Im Laufe des langen, trüben Herbstes hatte es seinen hellen Goldschimmer verloren, doch sie wusste, welche Mittelchen und Wässerchen seinen Glanz zurückbringen würden, in welche Tiegelchen sie greifen musste, um falsches Rot auf ihre Wangen, ihre Lippen zu legen.
Sie kannte alle Tricks. Wie sonst hätte sie einen Mann wie Reginald Harper auf sich aufmerksam machen können? Wie sonst hätte sie ihn dazu bringen können, sie zu seiner Geliebten zu machen?
Sie würde erneut auf alle diese Tricks zurückgreifen, dachte Amelia, um ihn noch einmal zu bezirzen, damit er tat, was getan werden musste.
Er war nicht gekommen – in all dieser Zeit, all diesen Monaten war er nicht zu ihr gekommen. So war sie gezwungen gewesen, ihm an seine Geschäftsadressen Nachrichten zu senden, in denen sie ihn anflehte, sie aufzusuchen. Er hatte sie ignoriert.
Ignoriert, nach allem, was sie getan hatte, nach allem, was sie gewesen war, nach allem, was sie verloren hatte.
Was war ihr anderes übrig geblieben, als ihm weitere Zeilen zu schreiben, und zwar nach Hause? An das große Harper House, in dem seine bleiche Gattin das Regiment führte. In das eine Geliebte niemals einen Fuß setzen konnte.
Hatte sie ihm nicht alles gegeben, was er sich wünschen, was er begehren konnte? Sie hatte ihren Körper feilgeboten für die komfortable Einrichtung dieses Hauses, für die Annehmlichkeit von Hauspersonal, für den Tand wie die Perlenohrgehänge, die sie nun an ihren Ohren befestigte.
Kein hoher Preis für einen Mann von seinem Format und seinem Reichtum, und darauf hatte sich einst ihr Ehrgeiz beschränkt. Sie hatte nur einen Mann gewollt und das, was er ihr geben konnte. Doch er hatte ihr mehr geschenkt, als einer von ihnen beiden erwartet hatte. Der Verlust davon war mehr, als sie ertragen konnte.
Warum war er nicht gekommen, um sie zu trösten? Um mit ihr zu trauern?
Hatte sie sich jemals beklagt? Hatte sie ihn je im Bett abgewiesen? Oder auch nur einmal die anderen Frauen erwähnt, die er sich hielt?
Sie hatte ihm ihre Jugend geopfert und ihre Schönheit. Und, so wie es aussah, ihre Gesundheit.
Und nun würde er sie im Stich lassen? Sich von ihr abwenden – jetzt?
Sie sagten, das Baby sei bei der Geburt nicht am Leben gewesen. Eine Totgeburt, hatte es geheißen. Ein tot geborenes Mädchen, das in ihr gestorben war.
Aber …
Hatte sie nicht gespürt, wie es sich bewegte? Gespürt, wie es trat und unter ihrem Herzen lebendig wurde? In ihrem Herzen. Dieses Kind, das sie nicht gewollt hatte, das ihr Ein und Alles geworden war. Ihr Leben. Der Sohn, den sie in sich großzog.
Der Sohn, der Sohn, dachte sie nun, während ihre Finger an den Knöpfen ihres Gewandes zupften. Immer wieder formten ihre angemalten Lippen diese Wörter.
Sie hatte ihn schreien gehört. Ja, ja, sie war sich sicher. Manchmal hörte sie ihn immer noch schreien, in der Nacht, er schrie nach ihr, damit sie kam und ihn tröstete.
Doch wenn sie ins Kinderzimmer ging, in das Bettchen schaute, war es leer. So leer wie ihr Mutterschoß.
Sie sagten, sie sei verrückt. Oh, sie hörte, was die Dienstboten, die noch übrig waren, flüsterten; sie sah, wie sie sie anschauten. Doch sie war nicht verrückt.
Nicht verrückt, nicht verrückt, dachte sie, als sie in dem Schlafzimmer auf und ab lief, das sie einst wie einen Palast der Sinnlichkeit behandelt hatte.
Nun wurde die Bettwäsche nur noch selten gewechselt, und die Vorhänge waren stets fest zugezogen, um die Stadt auszusperren. Und es verschwanden Dinge. Ihre Dienstboten waren Diebe. Oh, sie wusste, dass sie Diebe und Halunken waren. Und Spione.
Sie beobachteten sie, und sie flüsterten.
Eines Nachts würden sie sie in ihrem Bett umbringen. Eines Nachts.
Vor lauter Angst davor konnte sie nicht schlafen. Konnte nicht schlafen wegen der Schreie ihres Sohnes in ihrem Kopf. Er rief nach ihr. Rief nach ihr.
Sie war zu der Voodoo-Priesterin gegangen, erinnerte sie sich selbst. War zu ihr gegangen, um Schutz zu erhalten und Wissen. Für beides hatte sie mit dem Rubinarmband bezahlt, das Reginald ihr einmal geschenkt hatte. Mit den Steinen, die sich wie blutige Herzen vor dem eisigen Glitzern von Diamanten abhoben.
Sie hatte für das Schutzamulett bezahlt, das sie unter ihrem Kopfkissen aufbewahrte, und in einem Seidenbeutelchen über ihrem Herzen. Sie hatte bezahlt, teuer bezahlt, für den Wiederauferstehungszauber. Einen Zauber, der versagt hatte.
Weil ihr Kind lebte. Das war das Wissen, das die Voodoo-Priesterin ihr geschenkt hatte, und es war mehr wert als zehntausend Rubine.
Ihr Kleiner lebte, er lebte, und jetzt galt es, ihn zu finden. Es galt, ihn zu ihr zurückzubringen, wo er hingehörte.
Reginald musste ihn finden, musste dafür bezahlen, egal, wie hoch die Summe war.
Sachte, sachte, warnte sie sich selbst, als sie den Schrei in ihrem Hals pochen fühlte. Er würde ihr nur glauben, wenn sie ruhig blieb. Er würde nur auf sie hören, wenn sie schön war.
Schönheit verführte die Männer. Mit Schönheit und Charme konnte eine Frau bekommen, was immer sie wollte.
Sie wandte sich zum Spiegel und sah, was sie darin sehen musste. Schönheit, Charme, Anmut. Sie sah nicht, dass das rote Kleid an den Brüsten schlaff herunterhing, sich an den Hüften ausbeulte und ihre bleiche Haut in einem fahlen Gelb erscheinen ließ. Der Spiegel zeigte die wirr herabfallenden Locken, die allzu strahlenden Augen und das grelle Rouge auf den Wangen, doch ihre Augen, Amelias Augen, sahen nur, was sie einst gewesen war.
Jung und schön, begehrenswert und gerissen.
Also ging sie nach unten, um auf ihren Geliebten zu warten, und sang leise vor sich hin: »Lavendel ist blau, Lalilu. Lavendel ist grün.«
Im Salon brannte ein Feuer, und die Gaslampe war angezündet worden. Die Dienstboten würden also ebenfalls vorsichtig sein, dachte Amelia mit einem verkniffenen Lächeln. Sie wussten, dass der gnädige Herr erwartet wurde, und der gnädige Herr bestimmte über die Finanzen.
Ganz egal, sie würde Reginald sagen, dass sie gehen mussten, allesamt, und dass an ihrer Stelle andere eingestellt werden mussten.
Und sie wollte ein Kindermädchen für ihren Sohn, für James, wenn sie ihn wiederhatte. Eine Irin. Irinnen gingen fröhlich mit Babys um, glaubte sie. Sie wollte, dass ihr James eine fröhliche Kinderstube hatte.
Obwohl sie den Whiskey auf der Anrichte anstarrte, schenkte sie sich ein kleines Glas Wein ein. Sie ließ sich nieder, um zu warten.
Ihre Nerven begannen zu flattern, während die Zeit vorrückte. Sie trank ein zweites Glas Wein, dann ein drittes. Als sie durch das Fenster Reginalds Kutsche halten sah, vergaß sie, vorsichtig und ruhig zu bleiben, und flog zur Tür.
»Reginald, Reginald.« Kummer und Verzweiflung sprangen aus ihrem Mund wie Schlangen, zischend und zappelnd. Sie warf sich an seinen Hals.
»Beherrsch dich, Amelia.« Seine Hände schlossen sich um ihre knochigen Schultern, schoben sie von sich. »Was werden die Nachbarn sagen?«
Er schloss rasch die Tür, und auf seinen scharfen Blick hin hastete eine bereitstehende Bedienstete herbei, um ihm Hut und Gehstock abzunehmen.
»Das ist mir egal! Oh, warum bist du nicht früher gekommen? Ich habe dich so gebraucht. Hast du meine Briefe bekommen? Die Dienstboten, sie lügen. Sie haben sie nicht abgeschickt. Ich bin hier eine Gefangene.«
»Red keinen Unsinn.« Ein flüchtiger Widerwillen huschte über Reginalds Gesicht, als er ihren nächsten Versuch, ihn zu umarmen, abwehrte. »Wir hatten vereinbart, dass du niemals versuchen würdest, mich zu Hause zu erreichen, Amelia.«
»Du bist nicht gekommen. Ich war allein. Ich …«
»Ich hatte zu tun. Aber nun komm. Setz dich. Nimm dich zusammen.«
Doch immer noch hing Amelia an seinem Arm, als er sie in den Salon führte.
»Reginald. Das Baby. Das Baby.«
»Ja, ja.« Er befreite sich von ihr und schob sie auf einen Stuhl. »Eine bedauerliche Sache«, sagte er, während er zur Anrichte hinüberging, um sich einen Whiskey einzuschenken. »Der Arzt hat gesagt, es war nichts zu machen, und du brauchtest Ruhe und Erholung. Ich habe gehört, du hättest dich nicht wohl gefühlt.«
»Lügen. Das ist alles Lüge.«
Er wandte sich ihr zu; sein Blick registrierte ihr Gesicht, das schlecht sitzende Kleid. »Ich kann selbst sehen, dass es dir nicht gut geht, Amelia. Vielleicht ein wenig Seeluft, denke ich, das würde dir gut tun.« Sein Lächeln war kühl, als er sich an den Kaminsims lehnte. »Wie würde dir eine Ozeanüberfahrt gefallen? Ich glaube, das wäre genau das Richtige, um deine Nerven zu beruhigen und deine Gesundheit wieder herzustellen.«
»Ich will mein Kind. Er ist alles, was ich brauche.«
»Das Kind ist tot.«
»Nein, nein, nein!« Amelia sprang erneut auf, um sich an ihn zu klammern. »Sie haben ihn gestohlen. Er lebt, Reginald. Unser Kind lebt. Der Arzt, die Hebamme, sie haben alles geplant. Ich weiß jetzt alles, ich verstehe alles. Du musst zur Polizei gehen, Reginald. Dort werden sie dir zuhören. Du musst bezahlen, ganz gleich, wie viel Lösegeld sie...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.