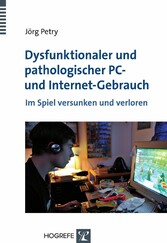Suchen und Finden
2 Medienpsychologische Grundlagen (S. 29-30)
Zusammenfassung
Innerhalb der Medienpsychologie hat sich eine rezipientenorientierte Vorstellung durchgesetzt, derzufolge computervermittelte Kommunikationsprozesse auf dem Hintergrund eines komplexen Bedingungsgefüges stattfinden und Medienwirkungen nicht isoliert betrachtet werden können. Im Zentrum der Kommunikation wird ein kreativ handelnder Rezipient angenommen, der diesen Prozess aktiv steuert und der sich der Unterscheidbarkeit von Virtualität und Realität bewusst ist. Die virtuelle Erlebnisweise der „Versunkenheit“ lässt sich anhand der sinnlichen Qualitäten des Mediums. der Motivation des Nutzers sowie des situativen und sozialen Kontextes charakterisieren. Aktuelle medientheoretische Ansätze sehen die Nutzung der Neuen Medien im „Normalfall“ als eine Erweiterungsmöglichkeit der Face-to-Face-Kommunikation an. Mögliche Einschränkungen und Gefahren dieser neuen Kommunikationsart müssen in Abhängigkeit von den sozioökonomischen Rahmenbedingungen, dem situativen Kontext und Unterschieden in den Persönlichkeiten der Kommunikationspartner bewertet werden.
2.1 Erklärungsansätze zur Mediennutzung
Die klassische Medienpsychologie (Winterhoff-Spurk, 2004) hat sich schwerpunktmäßig mit dem Fernsehen als Massenmedium beschäftigt und war als Wirkungsforschung konzipiert. Ziel war die empirische Erfassung der kognitiven Medienwirkungen, d. h. der Veränderung von Einstellungen und Wissen, der emotionalen Wirkungen speziell beim Einsatz des Fernsehens als Mittel der Gefühlsregulation und der verhaltensbezogenen Wirkungen der Medien, insbesondere das Auslösen anti- bzw. prosozialen Verhaltens. Dabei konnten einseitig zugespitzte kulturpessimistische Bewertungen aus den 1980er Jahren (Maletzke, 1988, Postman, 1985), die bis heute anhalten (Spitzer, 2005, vgl. Kap. 1.2), relativiert werden.
Einen Themenschwerpunkt bilden nach wie vor problematische Medienwirkungen, z. B. im Bereich aggressiven Verhaltens. Nach heutiger Ansicht führen Gewaltdarstellungen nicht unmittelbar zur Gewaltausübung, sondern liefern aggressive Muster, die unter bestimmten Rahmenbedingungen, wie z. B. der Verfügbarkeit von Waffen, dem Vorliegen bestimmter Persönlichkeitsmerkmale (z. B. Impulsivität) und situativer Faktoren (Rauschmitteleinfluss), aggressionsfördernd sein können. Dasselbe gilt für Video- (Knoll, 1993) und moderne Computerspiele (Hartmann, 2006), welche sich häufig aus militärischen Simulationsspielen ableiten (Grossmann & DeGaetano, 2003). Waldrich (2007) weist am Beispiel jugendlicher Amokläufer eindringlich darauf hin, dass dieses Phänomen nicht einseitig auf das Medium PC/Internet zurückzuführen ist, sondern erst auf dem Hintergrund entfremdeter Lebensverhältnisse verständlich wird. Diese führen dem Autor nach dazu, dass Heranwachsende zu wenig soziale Anerkennung erhalten und keine befriedigenden Bindungserfahrungen mehr erleben. In einem leistungsori entierten Schulsystem, das ständig Verlierer „produziert“, kann es im Extremfall dazu kommen, dass unter Rückgriff auf die in Gewaltspielen eintrainierten Muster bei anfälligen Persönlichkeiten ein Amoklauf entsteht.
Eine aktuelle Debatte beschäftigt sich mit einem „neuen“ Sozialcharakter, den man in einschlägigen Talkshows beobachten kann, und der sich durch seine emotionale Oberflächlichkeit und sein Bedürfnis nach theatralischer Inszenierung auszeichnet (Winterhoff- Spurk, 2005). Illouz (2007) führt dazu aus, dass diese zunehmende öffentliche Zurschaustellung des privaten Selbst in der kapitalistischen Ökonomisierung des persönlichen Gefühlslebens wurzelt. Die Autorin schließt damit neue Formen der Gefühlsäußerung im Internet, insbesondere in Partnerbörsen, ein.
Bereits in den 1970er Jahren fand – bezogen auf die alten Medien (Zeitung, Rundfunk und Fernsehen) – ein Paradigmenwechsel in der Medienforschung statt. Die medienzentrierte Sichtweise, der zufolge vor allem Massenmedien linear und kausal auf den Konsumenten einwirken, wurde durch eine rezipientenorientierte Sichtweise abgelöst. Dieser Annahme lagen empirische Befunde zugrunde, nach denen Rezipienten sich nicht wahllos Medienbotschaften aussetzen sondern selektiv – vor allem durch ihre persönlichen Einstellungen und Bedürfnisse gesteuert – Medien auswählen und nutzen. Darüber hinaus konnte am Beispiel von Wahlentscheidungen empirisch gezeigt werden, dass der Einfluss von Massenmedien geringer ausfällt, als die Beeinflussung durch persönliche Kontakte und die Normen von Bezugsgruppen (Vogel et al., 2007).
Ein bis heute bedeutsames Erklärungsmodell der aktiven, selektiven Mediennutzung ist der Uses-and-Gratifications-Ansatz von Katz und Mitarbeitern (1974). Die Nutzung von Medien sollte immer vor dem Hintergrund der individuellen Motivationen und Zielsetzungen des Rezipienten gesehen werden. Der Rezipient ist sich seiner Bedürfnisse und Motive bei der Medienwahl und deren Nutzung bewusst. Er entscheidet sich aktiv unter Berücksichtigung alternativer Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung für die Nutzung oder Nichtnutzung von Medien und natürlich auch für oder gegen spezifische Medien und die darin enthaltenen unterschiedlichen Formate und Anwendungsformen.
Bezogen auf das Fernsehen führt Keppler (2006) aus, dass dem Konsumenten die Differenz zwischen realitätsbezogenen Dokumentationen und fiktiven Darstellungen gerade durch das Nebeneinander vielfältigster Formate (Dokumentation, Doku-Soap, Nachrichten, Quizsendung, Talkshow, Schauspiel, Spielfilm, Gameshow, Werbung etc.) ständig bewusst ist. Wir erkennen beim Einschalten einer Sendung aufgrund der Variation des wahrnehmbaren Kontextes auf Anhieb den mehr oder minder ausgeprägten Realitätsbezug des Dargestellten. Von Früh (2002) wurde das bewusste Erleben der virtuellen Vermittlung beim Video- und Computerspielen thematisiert. Er kritisiert die im medienphilosophischen Diskurs angesprochene Annahme, dass der Nutzer des Mediums PC/ Internet vollständig in eine andere Welt eintrete und die Welt, in der er sich körperlich befindet, völlig vergesse. Der Autor erklärt dies anhand eines Abenteuer-Rollenspieles, bei dem der Nutzer in einem fernen Land gegen Monster kämpft. Er hinterfragt, warum dieser nicht spätestens bei dem zweiten Fehlschuss in Panik gerate und stellt die grundsätzlich Frage: „Was sollte einen total involvierten Zuschauer oder Videospieler, dem das Bewusstsein der Vermitteltheit völlig abhanden gekommen ist, überhaupt noch veranlassen, aus der virtuellen Welt wieder auszusteigen?“ (Früh, 2002, S. 133).
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.